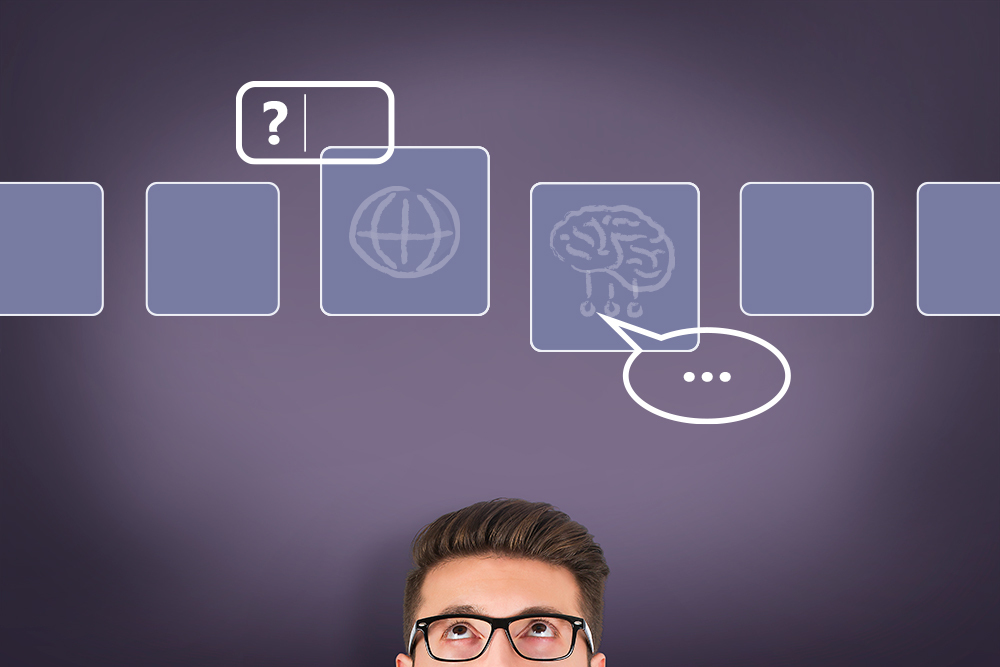Ersetzt die KI-Suche also schon die klassische Google Suche? Oder sprechen wir hier eher von einem Nebeneinander als von einem Verdrängen? Ein Blick auf aktuelle Zahlen und Studien zeigt eine spannende Entwicklung, die wir in diesem Blogbeitrag mit Ihnen teilen möchten.
Die Entwicklung der Informationsbeschaffung
Bis vor wenigen Jahren war Google die zentrale Anlaufstelle für die Informationssuche im Internet. In den letzten Jahren sind jedoch weitere Kanäle zur Informationsbeschaffung hinzugekommen. Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube werden vor allem von der jungen Zielgruppe als Suchmaschinen genutzt. Sprachassistenten wie Alexa und Siri helfen bei einfachen Fragen im Alltag. Mit der Verbreitung von Large Language Models (LLM) wie ChatGPT und vergleichbaren Tools ist zudem eine völlig neue Form der Recherche entstanden: dialogbasiert, oft ausführlicher und mit persönlicher Ansprache. Doch wie stark wird KI tatsächlich genutzt? Und in welchem Verhältnis steht sie zur klassischen Suchmaschine?
Zahlen, Daten, Fakten: Das sagen aktuelle Studien
Die aktuelle „State of Search“-Studie von Claneo von 2025 liefert einen spannenden Überblick. Dafür wurden Internetnutzer:innen aus Deutschland und den USA befragt, wie sie aktuell Informationen im Internet suchen. Mit 67 % bleibt Google vorerst die Anlaufstelle unter den Search-Tools. Spannender wird es bei den Alternativen: Ein Drittel der Befragten hat bereits KI-gestützte Tools wie ChatGPT genutzt, um Informationen zu finden. Ebenfalls ergab die Studie, dass Nutzer:innen den Ergebnissen der KI im Vergleich zu 2024 viel mehr Glaubwürdigkeit beimessen. Bei ChatGPT wurde ein Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, sodass 79 % der Befragten im Jahr 2025 die Frage „Wie sehr vertraust du folgenden Plattformen?” mit „sehr” beantworteten.
Diese Zahlen zeigen, dass die KI-Suchen aufholen, doch Googles Dominanz bleibt klar bestehen. Viele Menschen kombinieren mittlerweile verschiedene Kanäle, je nachdem, welche Art von Information sie benötigen. Während Google bei schnellen, faktenbasierten Recherchen weiterhin punktet, greifen Nutzer:innen bei komplexeren Fragen oder für besonders ausführliche Erklärungen immer öfter zu KI-gestützten Tools. Diese Tendenz wird durch eine ähnliche Untersuchung der SaaS-Plattform Semrush für Online-Sichtbarkeit und Content-Marketing bestätigt. KI-Suchen haben sich etabliert. Sie sind kein Hype mehr, sondern eine echte Ergänzung im Repertoire der Online-Recherche. Dennoch bleibt Google aktuell der am häufigsten genutzte Informationskanal.
Warum nutzen Menschen KI-gestützte Suchanfragen?
Warum wenden sich immer mehr Menschen an ChatGPT, Gemini oder Claude, statt ausschließlich die klassische Google Suche zu nutzen? Ein Grund dafür ist die Art und Weise, wie diese Tools funktionieren. Anstelle kurzer Schlagwortanfragen ermöglichen sie einen echten Dialog. Nutzer:innen können Fragen in vollständigen Sätzen stellen. Sie können nachhaken, wenn etwas unklar bleibt, und so mit der KI in einen Austausch treten. Diese Gesprächsform führt dazu, dass die Antworten oft ausführlicher ausfallen und individueller wirken. Wer eine KI befragt, erhält in der Regel keine bloße Liste mit Links, sondern eine direkt formulierte Antwort.
Gerade bei komplexen Themen oder Aufgaben, die Kreativität erfordern, ist das von Vorteil. Tippt man beispielsweise „Bewerbung schreiben” in die Google Suche ein, werden eine Vielzahl an Webseiten mit Ratschlägen angezeigt. Eine KI hingegen erstellt auf Wunsch gleich einen individuellen Bewerbungstext, der an das Berufsfeld und die Erfahrung angepasst ist. Auch bei Problemlösungen oder der Ideenfindung setzen immer mehr Menschen auf die Unterstützung durch KI.
Gleichzeitig schätzen viele Nutzer den Kontextbezug, den KI bieten kann. Während klassische Suchmaschinen für jede Suchanfrage bei Null starten, merken sich KI-Modelle innerhalb eines Gesprächsverlaufs vorherige Informationen. Dadurch wirken die Antworten oft persönlicher und passender.
Der Einfluss auf SEO und Marketing
Für Unternehmen, die online sichtbar bleiben wollen, bringt diese Entwicklung neue Herausforderungen mit sich. Die klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) bleibt zwar weiterhin wichtig, doch sie reicht allein nicht mehr aus. Inhalte müssen künftig so formuliert werden, dass sie nicht nur in den Suchergebnissen von Google auftauchen, sondern auch von künstlichen Intelligenzen verstanden, verarbeitet und möglichst zitiert und empfohlen werden können.
Dafür müssen Texte stärker auf natürliche Sprache ausgerichtet sein. Keyworddichte und Meta-Tags sind nicht ausreichend. KI versteht Zusammenhänge und Inhalte immer besser. Deshalb entscheidet die inhaltliche Qualität eines Textes zunehmend darüber, ob er in einer KI-Antwort berücksichtigt wird. Wer künftig online gefunden werden will, muss Inhalte bieten, die Themen umfassend und verständlich behandeln. Gleichzeitig bleibt die klassische Google-Optimierung unerlässlich, denn hier erreicht man nach wie vor den Großteil der Internetnutzer:innen.
Spannend ist die Frage, wie Suchmaschinen diesen Wandel selbst aufnehmen. Google hat mit der „Übersicht mit KI“ bereits die KI-gestützten Antworten in die klassische Suche integriert.
Andere Plattformen wie Perplexity zeigen, wie eine Symbiose aus Suchmaschine und KI-Dialog aussehen kann. Im Vergleich zu ChatGPT konzentriert sich Perplexity AI stärker auf das Abrufen von Fakten und zitatenbasierten Informationen. Das macht es zu einer besseren Option für Forschungszwecke. Zwar liefert es äußerst zuverlässige und genaue Daten, verfügt jedoch nicht über die Konversationstiefe und Kontextbeibehaltung von ChatGPT.
Für Unternehmen bedeutet das: Inhalte müssen heute und in Zukunft sowohl für Suchmaschinen als auch für KI-Modelle erstellt werden. Eine Doppelstrategie, die zwar mehr Aufwand bedeutet, aber auch neue Chancen eröffnet.
Wird die KI-Suche künftig zur neuen Normalität?
Ein vollständiger Wechsel hin zur KI-basierten Suche ist kurzfristig nicht zu erwarten. Die Gewohnheit ist zu groß und das Vertrauen in klassische Suchmaschinen zu stark. Gleichzeitig wird die Rolle von KI in der Informationssuche in den nächsten Jahren spürbar zunehmen. Diese Entwicklung wird vermutlich nicht als plötzlicher Bruch, sondern als schleichender Übergang zu einem hybriden Suchverhalten erfolgen.
Schon jetzt zeigt sich eine Art Aufgabenteilung: Für komplexe Anfragen, kreative Ideenfindung oder individuelle Formulierungen greifen viele zur KI. Wer hingegen schnelle Fakten sucht, verlässt sich weiterhin auf Google. Auch aktuelle Nachrichten und tagesaktuelle Informationen sind dort verlässlicher zu finden. Hinzu kommt, dass viele Nutzer:innen noch immer skeptisch sind, wenn es um die Verlässlichkeit von KI-generierten Inhalten geht.
Als „Halluzinationen” werden Ergebnisse der KI bezeichnet, die sprachlich zwar überzeugend wirken, jedoch inhaltlich nicht korrekt sind und sich nicht durch die zugrunde liegenden Daten belegen lassen.
Auch wenn heutige KI-Modelle durch Funktionen wie „Websearch” auf einen aktuellen Wissensstand zugreifen können, schrecken viele Menschen vor der Verwendung der Modelle zur Suche und Recherche zurück, da Halluzinationen nicht ausgeschlossen werden können.
Fazit
Die aktuelle Datenlage zeigt deutlich: KI-Suchen wachsen, doch Google bleibt klar führend. Je nach Fragestellung entscheiden sich Nutzer:innen heute bei ihrer Online-Suche nach Informationen zwischen KI und klassischer Suchmaschine. Die beiden Kanäle ergänzen sich, stehen also bisher noch nicht in direkter Konkurrenz zueinander, sondern erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse. Für schnelle, präzise Informationen bleibt Google unschlagbar. Für ausführliche Antworten, Kontext oder kreative Unterstützung haben sich KI-gestützte Tools hingegen als sinnvolle Ergänzung etabliert.
Für Unternehmen und Content-Ersteller bedeutet das: Inhalte müssen künftig doppelt gedacht werden. Sie sollten suchmaschinenoptimiert sein und so formuliert werden, dass sie auch von KI-Systemen sinnvoll genutzt und weitergegeben werden können. Das eröffnet neue Möglichkeiten, Inhalte passend für verschiedene Recherchewege aufzubereiten.